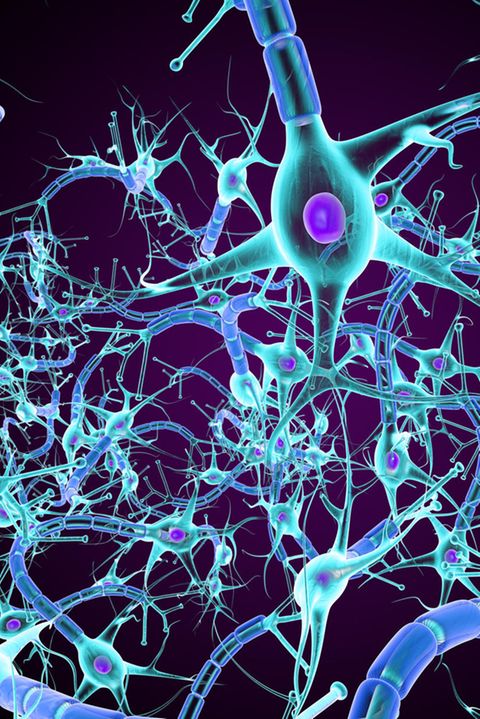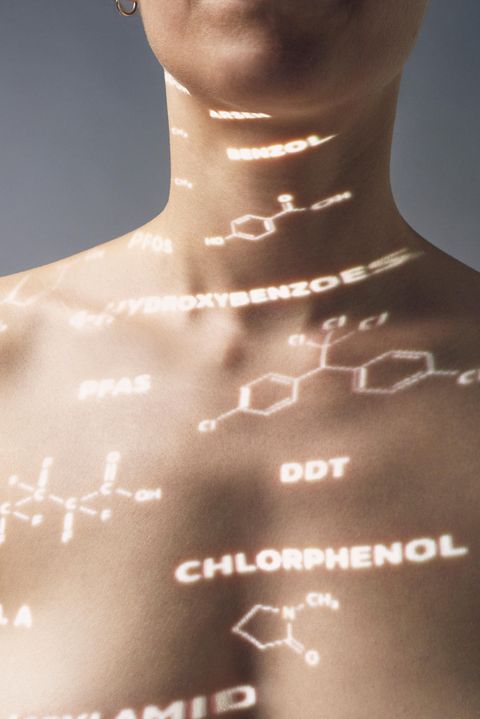Zum Beispiel La Boqueria, die legendäre Markthalle von Barcelona direkt an den Ramblas. An jedem beliebigen Tag ist es hier pickepackevoll mit Touristen, die sich durch die Gänge schieben, um Pata-Negra-Schinken, Berge glänzender Scampi und kunstvoll aufgefädelte Peperoni-Girlanden zu fotografieren, die sie bereits von Fotos kennen. Gekauft wird natürlich nichts, was soll man auch mit einem Pfund Scampi im Hotelzimmer? Also haben die zu Tode fotografierten Händler aus Notwehr das Angebot modifiziert. Es gibt jetzt Plastikbecher mit vorgeschnittener Honigmelone und kleine Tüten mit Schinkenfitzelchen to go – total vertrocknet zwar, ist ja auch nur für Touristen.
Diskussion: Lars Nielsen, Chefredakteur von GEO Saison, im Video-Interview

"GEO Saison"-Chefredakteur Lars Nielsen im Interview
Was denken Sie über Overtourism? Haben Sie Ideen, wie wir in Zukunft reisen können, ohne eine Last für Land und Leute zu sein? Und welche Rolle sollte Geo Saison spielen? Wir haben unsere Leser gebeten, uns zu diesen Fragen ihre Meinung zu schicken und mit uns auf Facebook zu diskutieren. In diesem Video geht Chefredakteur Lars Nielsen auf die Zuschriften ein. Vielen Dank für Ihre Beiträge!
Die Einheimischen bleiben zunehmend weg: keine Lust, sich für den täglichen Einkauf durch die Menschenmassen zu zwängen, keine Lust auf Mondpreise für zweitklassige Ware. Und die Touristen? Die maulen auch. Vorgeschnittene Melone, das ist doch was für Touristen! Diese Wegwerfbecher, das sieht doch nicht gut aus! Sie wollen das Authentische, das Originale, den Flair eines Mittelmeermarktes, sie wollen ganze Schinken sehen, wie versprochen, verdammt!
So, und jetzt noch mal von vorn. Geschrieben habe ich: die Touristen. Gemeint habe ich: mich. Ich stehe mitten im Markttrubel, fühle mich fehl am Platz und finde alles schrecklich. Die Leute, das Geschiebe lösen bei Einheimischen wie Besuchern spürbare Genervtheit aus. Spaß macht das keinem. Doch am schlimmsten finde ich mich selbst. Ich würde mich liebend gern über die Easyjet- und Airbnb-Touristen mokieren, die diese Stadt verstopfen und verschandeln. Aber die Wahrheit ist: Ich bin einer von ihnen. Ein weiterer Tropfen in der Besucherflut, genauso schuld an der Misere wie die anderen jährlich 30 Millionen Besucher, die Barcelona von einer der schönsten Städte in eine der unerträglichsten verwandeln. Was habe ich also hier zu suchen?
»Der Tourist zerstört das, was er sucht, indem er es findet«
Die Tragödie des Tourismus – von Hans Magnus Enzensberger ewig gültig zusammengefasst mit »Der Tourist zerstört das, was er sucht, indem er es findet« – hat sich in den letzten Jahren zu einem Problem verschärft, das Tourismusbehörden und -forscher unter der Modevokabel »Overtourism« führen. Jedes Jahr werden weltweit neue Allzeithochs in den Besucherzahlen erreicht, Städte wie Lissabon, Prag, Dubrovnik, Berlin und Athen, aber auch einst abgeschiedene Gegenden wie Island werden überrannt; ihre Bewohner fühlen sich wie unbezahlte Statisten in einem Freilichtmuseum, das bis eben noch ihr Zuhause war. Die Vokabeln, mit denen die Situation geschildert wird, stammen aus dem Lexikon der Kriegs-, Katastrophen- und Krankheitsberichterstattung: Invasion. Überflutung. Plage. Infarkt. Kollaps.
Ein paar Zahlen: 2016 sind weltweit 1,23 Milliarden Touristen ins Ausland gereist, etwa die Hälfte davon nach Europa. Damit ist die Zahl seit 1950 um das Vierzigfache gestiegen; bis 2030, so schätzt die Welttourismusorganisation UNWTO, dürfte sie auf 1,8 Milliarden wachsen: Eine neue reisehungrige Mittelschicht in China, Russland, Brasilien steht erst in den Startlöchern. In Venedig treffen täglich rund 60 000 Touristen auf vielleicht 5000 verbliebene Venezianer im touristischen Zentrum rund um den Markusplatz, das macht 12 Besucher auf jeden Bewohner. Venedigs Bürgermeister Luigi Brugnaro ist das erste Stadtoberhaupt in der Geschichte, das nicht in der Serenissima selbst, sondern auf dem Festland wohnt. Er wird schon wissen, warum.
Die Fremdenverkehrsverbände, die bislang aus dem Händereiben gar nicht mehr herauskamen, sehen inzwischen ein, dass ihre Gelddruckmaschinen explodieren könnten, wenn sie weiterhin so heiß laufen. Bislang sind die Eingriffe noch halbherzig und zaghaft: Klar muss man was tun, das sagen zumindest alle, aber die Besucher vergraulen wolle man ja nun auch nicht. Ende des Jahres soll in Dubrovnik eine App anzeigen, wenn die Altstadt zu voll ist, und den Weg zu anderen Sehenswürdigkeiten weisen. Andere Konzepte setzen eher erfolglos auf Abschreckung durch Gebührenmodelle: Auf Mallorca müssen Urlauber seit 2016 eine Touristenabgabe zahlen – trotzdem reisten 2017 4,5 Millionen Deutsche ein, gut sechs Prozent mehr als im Vorjahr. Die Nutzung des überlaufenen Wanderwegs Sentiero Azzurro, der die Cinque-Terre-Dörfer verbindet, kostet Eintritt, derzeit wird darüber nachgedacht, ob und wann feste Startzeiten ausgegeben werden. Dasselbe gilt für die legendären Wellen vor der indonesischen Inselgruppe Mentawai: Wer sie surfen will, zahlt eine Nutzungsgebühr in Höhe von einer Million Indonesischer Rupien (knapp 60 Euro) und kriegt ein Armbändchen zur Autorisierung umgetüdelt. Auch die berühmte Serpentinenstraße Lombard Street in San Francisco dürfte demnächst davon betroffen sein: Mehr und mehr öffentliche Orte sollen künftig behandelt werden wie Museen, wie die Uffizien zum Beispiel oder Schloss Sanssouci, für die man zeitgebundene Eintrittskarten vorbestellen muss. Städte wie Dubrovnik werden künftig vermutlich wie angesagte Restaurants gemanagt werden: Sie wollen einen Tisch am Freitagabend um 20 Uhr? Vergessen Sie’s. Frei wäre was am Mittwoch um 18 Uhr, und zwar in drei Wochen, take it or leave it. Bislang ist allerdings völlig ungeklärt, wie das gehen soll: Wie reguliert man den Zugang zu einer Stadt? Mit Kassenhäuschen an Flughäfen und Einfallstraßen?
Ein weiterer Versuch der Tourismusbehörden: entlegene Stadtteile hip machen. In New York versucht man derzeit, einen Teil der Massen nach Brooklyn oder Queens zu ködern, Amsterdam hat die 30 Minuten von der Stadt entfernten Strände von Zandvoort und Bloemendal kurzerhand in »Amsterdam Beach« umbenannt, um die Leute aus der Stadt zu locken. Denn nicht nur kleine Orte wie San Gimignano sind überlaufen, auch in Großstädten ballt es sich an den immer gleichen Hotspots. Da hilft nur brutales Zeitmanagement: Die Kronjuwelen im Londoner Tower kann man nur auf einem Förderband besichtigen, auf dem man an den Vitrinen mit dem Koh-i-Noor und der indischen Kaiserkrone von 1911 vorbeitransportiert wird. Fließbandtourismus.
Und Massen bleiben es ja auch dann, wenn man sie in die Vororte verklappt – dann stören sie halt woanders. Oder zu anderen Zeiten: Die Saison zieht sich vielerorts übers ganze Jahr, der Nervfaktor für die betroffenen Einwohner, die sich zunehmend in Großdemos und Bürgerinitiativen kontra Tourismus organisieren, auch. Prekär war das Verhältnis von Einheimischen und Touristen schon immer. Niemand mag Touristen, sie mögen sich ja noch nicht mal selbst. Denn keiner will Tourist sein – Touristen, das sind immer nur die anderen.
Die schlimmen Sauf- und Junggesellenabschiedstouristen, die Pauschalbucher, die einem erhobenen Regenschirm hinterhertrotten – aber doch nicht man selbst! Man ist schließlich Traveller, Individualreisender, Backpacker, das ist doch was ganz anderes! Eben nicht, Schädling ist man mindestens genauso sehr. Man ist – nicht zuletzt auch in Zeitschriften wie GEO Saison – auf der ewigen Suche nach Geheimtipps, nach Orten, wo die locals hingehen, und versaut den locals im Erfolgsfall verlässlich ihre letzten Zufluchtsstätten. Man sucht das Authentische – und verlangt doch nur eine heile Welt, bevölkert von gut gelaunten Einheimischen, die sich bitte zu freuen haben, wenn man neben ihnen am Tresen ihrer Stammkneipe steht. Doch die bittere Wahrheit ist: Man stört.
Golfclub für Besserverdienende und Kinderlose
Das Dilemma ist nicht zu lösen. Klar kann man nach Transsilvanien, Suriname oder Malawi ausweichen, sich »abseits der Trampelpfade« begeben, wie es immer so schön heißt, trampelt dadurch aber einfach nur neue Pfade aus. Und die Strategie, den Zugang zur Welt durch immer höhere Eintrittspreise und feste Zugangszeiten zu regulieren? Soll sich die Erde wirklich in einen gigantischen Golfclub für Besserverdienende und Kinderlose verwandeln, wie es für einige Orte bereits gilt, für die Seychellen, Malediven, Bhutan?
Es beginnt vermutlich damit, dass man sich eingesteht: Jawohl, es gibt ein Problem, und ich bin Teil davon. Reisen hat längst seine Unschuld verloren, die Zuständigkeit für den Erhalt einer halbwegs erträglichen Welt kann man an kein Tourismusbüro abwälzen. Wenn man Fernreisen wie Butterfahrten betrachtet und Kurztrips im Billigflieger für ein Menschenrecht hält, darf man sich nicht wundern, von Einheimischen mit Pfeifkonzerten und »Tourist go home«-Plakaten begrüßt zu werden. Wie es sich anfühlt, besucht und besichtigt zu werden, erlebt man in deutschen Städten ja zunehmend am eigenen Leib. Umso leichter lässt sich der Groll der Touristenhochburg-Einwohner nachempfinden, umso größer hoffentlich die Lustlosigkeit, dazu beizutragen.
Was also tun? Zu Hause bleiben? Ja, vielleicht öfter mal. Erwartungen beerdigen, dass am Ende jedes Fluges das Paradies auf einen wartet? Unbedingt. Ich vermute, dass sich unser Verhältnis zum Reisen in den kommenden Jahrzehnten stark verändern wird. Aus der konsumistischen Selbstverständlichkeit der jüngsten Vergangenheit wird eine neue Haltung erwachsen, eine gesellschaftliche Einsicht: Ein Wochenendtrip nach New York dürfte dann ähnlich geächtet werden wie Billigfleisch vom Discounter oder eine ins Meer entsorgte Plastikflasche. Geht nicht. Macht man nicht. Und wenn man wirklich unbedingt im Juli nach Barcelona fliegen und in La Boqueria sinnlose Fotos schießen muss, dann hat man es einfach nicht besser verdient.